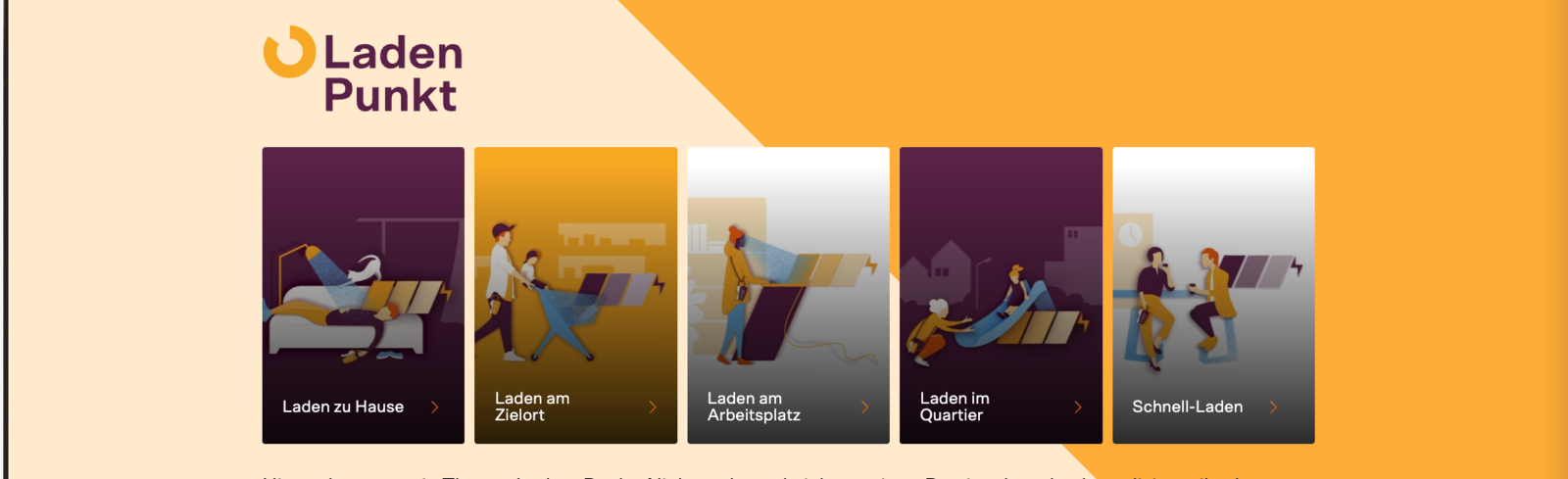Werbung
So laden wir in der Zukunft
An Fragen zur E-Mobilität herrscht kein Mangel. Eine davon: Kommen endlich mehr Ladesäulen, wo sollen Mieter laden – und was macht eigentlich der Bund? Die verblüffende Antwort: Da tut sich eine ganze Menge. Eine Momentaufnahme zur Entwicklung der Ladeinfrastruktur.
Spätabends im Elektroauto unterwegs und fast daheim. Nur können wir zuhause nicht laden, weil wir zur Miete leben. Na gut, ab zur Ladestation. Ein Hinterhof, kein Dach, dafür Regen– und nun zickt die Ladekarte. Bitte erst online registrieren und einen QR-Code generieren, sagt das Display. Ernsthaft jetzt? Mal ehrlich: Nicht Preis(sinkt), Reichweite und Ladezeit (steigen) sind die E-Crux. Sondern unfreiwillige Ladeabenteuer.
Übellaunig denken wir: Macht der Bund da nichts? Grund genug, sich mal über Szenarien des Bundesamtes für Energie (BFE) zu beugen. Überraschung: Doch, er macht, der Bund. Einfach auf Schweizer Art: Zwar setzen wir anders als andere Staaten nicht auf fette Subventionen, Elektro soll sich selbst beweisen. Aber hinter den Kulissen läuft viel. Wie beim BFE und dessen «Roadmap Elektromobilität». Dort machen dutzende Player mit, ob ABB oder Siemens, SBB oder Swisscom oder Städteverband, von Autoimporteuren (Auto-Schweiz) bis Garagengewerbe (AGVS) oder TCS. Die Idee: Stolpersteine der E-Zukunft aufspüren und Lösungen finden.
Laden wird uns unweigerlich beschäftigen
Man kann E-Autos gut finden oder nicht, über Ökobilanzen und Verbrennerverbote streiten. Klar darf man auch auf E-Fuels und Wasserstoff hoffen. Fakt ist aber: Die sind noch Visionen – aber die Elektriker, die sind längstda. Der Bestand liegt zwar erst bei etwas über drei Prozent, aber trotz jüngster Stagnation der Anteil reiner Elektroautos bei Neuwagen bereits bei 18 Prozent. Jedes fünfte Auto. Laden wird also zum Thema.
Vor allem im Land der Mieterinnen und Mieter: 58 Prozent leben hierzulande zur Miete, und die zwölf Prozent Stockwerkeigentümer haben häufig dasselbe Problem. Deutschland hat nun dazu ein Gesetz, dass Vermieter Wallboxen erlauben müssen. In der Schweiz scheiterte so ein Vorstoss, auch eine geplante Bundesförderung kippte (viele Kantone fördern jedoch): Konkordanz und Überzeugungsarbeit sind hierzulande eher gefragt – und, das hört man an «Roadmap»-Meetings immer wieder: Businessmodelle. Bereits laufen Immobilien mitWärmepumpe besser, für Ladeinfrastruktur deutet es sich an – und plötzlich ändern Vermieter ihre Meinung.
In Quartieren müssen Ladepunkte kommen
Als Stütze gibt es einen Leitfaden «Ladestruktur in Mietobjekten» zum Download auf der eigens zum Thema Laden eingerichteten BFE-Seite «Laden-punkt.ch». Der soll aufzeigen, wie es geht. Denn, so sagt Delphine Morlier, Leiterin Mobilität BFE: «Wann immer möglich, sollte man zuhause laden können. Deshalb sollten bis 2035 zwei Millionen Heimladepunkte entstehen.» Aber es werde je nach Szenario – um nicht von der Realität rechts überholt zu werden, wird flexibel prognostiziert – 400'000 bis eine Million an Steckerautos geben, die in der Schweiz nicht privat laden können. Die sind ergo auf mehr Ladesäulen in den Quartieren angewiesen.
Bei den Ladesäulen liegen wir auf Kurs
Im BFE-Szenario (2035 im Bestand sechs von zehn Autos mit Stecker, drei Viertel davon batterieelektrisch) bräuchte es 19'000 bis 84'000 öffentliche Lader. Erstes Zwischenziel: 20'000 im Jahr 2025. Wo es doch 2022 gerade mal die Hälfte war. Reines Wunschdenken? Mitnichten, die Schweiz ist auf Kurs. Zur Halbzeit sind es je nach Quelle aktuell 14'000 bis 16'000. Und auch Themen wie das fehlende Dach über der Ladestation oder die zu komplexen Bezahlsysteme werden im Rahmen der «Roadmap» angegangen. Sonst will das niemand. Und auch hier gilt: Sobald Businessmodelle ins Spiel kommen, geht es voran. Ein Beispiel aus dem Zürcher Oberland: Ein Parkplatz, ein Carport mit Fotovoltaik – und schon kann man E-Autos Ladestrom verkaufen.
Bei Autobahnen ist das Bundesamt für Strassen (Astra) in der Pflicht. Fünf Anbieter bekamen vor fünf Jahren den Zuschlag, je ein Fünftel der Rastplätze zu versorgen; von 100 Parkplätzen laden aktuell 40 schnell, zwölf weitere sollen bis Ende 2024 folgen, und die 48 übrigen sollen binnen spätestens sechs Jahren. Raststätten sind bereits fast alle versorgt. Es muss sich noch viel tun? Stimmt. Aber tut sich ja. Und auch Benzin musste man in den ersten eineinhalb Jahrzehnten des Verbrennerautos in der Apotheke und Hinterhöfen kaufen.
Ladeland Schweiz im Europavergleich
Bei den öffentlichen Ladesäulen pro Kopf liegt die die Schweiz im europäischen Vergleich gut. In einer Studie landen wir unter unseren Nachbarländern knapp hinter Österreich und klar vor Frankreich, Deutschland und Italien. Unter 28 Ländern Rang sechs! Die Top Fünf: Norwegen, Luxemburg, die Niederlande, Schweden und Österreich. In einem Ranking zu Schnellladern pro 100 Kilometer Autobahn reicht es gar für den dritten Platz.
Werbung