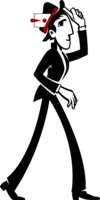Werbung
Hochspannung bis zum Schluss
Batterie-Recycling ist ein sehr komplexes Thema, dem bisher viel zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Vor allem bei der Konstruktion von Elektroautos bestehe hoher Verbesserungsbedarf, sagt Astrid Arnberger, Leiterin der F&E-Abteilung bei Saubermacher.
| Der Artikel stammt aus der Feder der Pragmaticus-Redaktion. Das Magazin mit Sitz im liechtensteinischen Schaan widmet sich den grossen Fragen unserer Zeit. Die Antworten kommen dabei direkt von namhaften Experten, die unverfälscht zu Wort kommen. STREETLIFE publiziert im Rahmen einer Kooperation regelmässig Pragmaticus-Artikel. |
In der Diskussion um die Nachhaltigkeit von Elektroautos spielte das Batterierecycling bisher kaum eine Rolle. Das Thema wird uns aber in wenigen Jahren mit grosser Wucht treffen. Allein zwischen 2019 und 2020 verdreifachten sich die Verkaufszahlen in Österreich und Deutschland, 2022 kamen weltweit über zehn Millionen Elektroautos und Plug-in-Hybride (PHEV) neu auf die Strasse. Das bedeutet auch, dass die Nachfrage nach wertvollen und knappen Rohstoffen immer grösser wird. Umso wichtiger ist es, bereits eingesetzte Primärrohstoffe als Ressourcen im Kreislauf zu halten.
Je nach Betrieb beträgt die Lebensdauer einer Batterie etwa sieben bis zwölf Jahre. Wenn Batterien von Elektrofahrzeugen nur mehr 80 Prozent ihrer Leistung erbringen, werden sie entsorgt, weil sie für anspruchsvolle Mobilitätsanwendungen nicht mehr geeignet sind. Die als Verkaufsargument gern angepriesenen Schnellladeverfahren können die Lebensdauer deutlich verkürzen. Grundsätzlich gilt: Je länger die Nutzungsdauer, desto besser die Ökobilanz.
Bedarf steigt exponentiell
Fakt ist, dass die Verwertung von Elektroautos deutlich herausfordernder ist als bei einem Verbrenner, was hauptsächlich an den Lithium-Ionen-Batterien liegt. Andererseits werden auf diese Weise wertvolle Rohstoffe zu einem sehr hohen Prozentsatz zurückgewonnen. Metalle wie Kupfer, Eisen, Aluminium sowie Nickel und Kobalt werden schon jetzt weitestgehend (zu 90 bis 95 Prozent) recycelt. Für die gesamte Batterie liegt der Wert bei rund 70 Prozent. In der neuen Batterieverordnung schreibt die EU-Kommission sogar Mindestanteile von rückgewonnenem Material (z. B. Kobalt und Lithium) vor. Dies hat wesentliche Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft und wird zu einer Veränderung des Marktes führen. Die neue Batterieverordnung ist sicherlich ein wesentlicher Erfolg für die Kreislaufwirtschaft. Um sämtliche Anforderungen erfüllen zu können, müssen Produzenten ihren administrativen Aufwand sehr stark steigern – ohne eine höhere Wertschöpfung für das jeweilige Unternehmen zu schaffen. Für kleinere Betriebe wird es so immer schwieriger, gegenüber grossen Unternehmen konkurrenzfähig zu sein.
Nimmt man das Jahr 2019 als Anfang des Elektro-Booms, ist in spätestens fünf Jahren mit hohem Recyclingbedarf zu rechnen, der danach exponentiell ansteigen wird. Derzeit erreichen selbst die leistungsfähigsten Anlagen ein Volumen von gerade einmal 15.000 Tonnen pro Jahr, was etwa 30.000 Elektroautos entspricht.
Kapazitäten lassen sich relativ schnell anpassen. Es sind bereits Grossanlagen in Bau, die aber derzeit noch ein wirtschaftliches Risiko darstellen. Denn es herrscht noch immer keine Einigkeit über eine optimale Vorgehensweise beim Recyclingprozess. Solange es keine Standards im Aufbau gibt, muss man sich an möglichst universellen Behandlungsschritten orientieren. Eine weitere Herausforderung sind die schnellen Entwicklungssprünge in der Lithium-Ionen-Technologie. Auch der mangelhafte Informationsfluss von den Herstellern spielt eine grosse Rolle. Wohl aus Wettbewerbsgründen wird bisher nur ein absolutes Minimum an Daten über den Aufbau der Batterie bekannt gegeben. Aber das ist zu wenig für Recyclingunternehmen, um eine optimale Verarbeitung planen zu können.
Zudem haben die Hersteller bisher wenig Augenmerk auf das spätere Recycling gelegt. Leistungszuwachs ging klar vor Nachhaltigkeit. Beispielsweise bestehen die Batterien eines führenden Produzenten aus mehreren tausend miteinander verklebten Einzelzellen, wie sie auch in Fernbedienungen zu finden sind. Eine Zerlegung in leichter handhabbare Elemente ist damit ausgeschlossen. Je weniger unterschiedliche Kunststoffe und je weniger Klebeverbindungen enthalten sind, desto höher kann die Recyclingquote ausfallen.
Recycling besser planen
Bei der Konstruktion neuer Modelle gewinnt die Recyclingproblematik erst langsam an Bedeutung. Idealerweise ist eine E-Auto-Batterie aus mehreren kompakten Modulen zusammengesetzt, die sich leicht demontieren und in ihrer Funktion einzeln überprüfen lassen. Herrscht dann auch noch vollständige Kenntnis über den chemischen Aufbau, wären ideale Voraussetzungen für ein zweites Leben als Stationärspeicher gegeben – etwa zur Überbrückung der Hell-Dunkel-Lücke bei Photovoltaikanlagen.
Aufbau und Leben einer Batterie müssten für die Wiederverwendung besser dokumentiert und organisiert werden. Fehlende Daten und die kaum auf ein zweites Leben ausgelegte Konstruktion machen den Umbau auf Stationärbetrieb bisher sehr aufwendig und damit teuer. Auch für die Gewährleistung und den Brandschutz würden mehr Informationen über das Ausgangsprodukt enorm helfen.
Insgesamt zeigt uns die Klimakrise, wie wichtig die Entwicklung hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft als Rohstofflieferant ist. Und derzeit ist es noch sehr aufwendig und langwierig, hochwertige Rohstoffe aus Abfällen in den Produktionskreislauf zurückzuführen.
Werbung