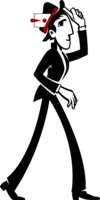Werbung
Klimapolitik braucht mehr Realismus und weniger Ideologie
Mehr Klima-Pragmatismus. Grüne Visionen stossen immer öfter an die Grenzen des Machbaren. Es ist Zeit für einen neuen Klima-Pragmatismus, der auch die Kosten und die Auswirkungen der Massnahmen auf die Wirtschaft berücksichtigt. Unserem Planeten würde das guttun.
| Der Artikel stammt aus der Feder der Pragmaticus-Redaktion. Das Magazin mit Sitz im liechtensteinischen Schaan widmet sich den grossen Fragen unserer Zeit. Die Antworten kommen dabei direkt von namhaften Experten, die unverfälscht zu Wort kommen. STREETLIFE publiziert im Rahmen einer Kooperation regelmässig Pragmaticus-Artikel. |
Vor sieben Jahren, im Sommer 2018, wurde «Fridays for Future» gegründet. Hauptsächlich in Europa, zum Teil auch in den USA, gingen Millionen von jungen Menschen auf die Strasse, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Greta Thunberg wurde zur Ikone und durfte auf dem UN-Klimagipfel auftreten. Grüne Parteien gewannen fast überall deutlich an Zustimmung, weil sie in der Umweltpolitik am glaubwürdigsten waren. Die ganze Welt schien sich damals hinter einem gemeinsamen Ziel zu versammeln: dem Kampf gegen die Erderwärmung.
Doch dann kam die Corona-Pandemie. Russland überfiel die Ukraine. Die Energiepreise stiegen massiv und verursachten die höchste Inflation seit Jahrzehnten. Der Wirtschaftsmotor begann zu stottern. Populisten und Autokraten erlebten weltweit einen Aufstieg.
Und plötzlich ist der Klimaschutz nur noch ein Thema unter vielen. Heute werden Fragen gestellt, die früher tabu waren: War die grüne Politik der letzten Jahre nur ein westliches Wohlstandsphänomen? Wurden utopische Ziele verfolgt, ohne die wirtschaftlichen Auswirkungen unter Kontrolle zu haben? Sind die Markteingriffe im Dienste der Energiewende mit schuld an der ökonomischen Misere, in der viele europäischen Länder – darunter Österreich – schon seit Jahren stecken?
Grüne Visionen sind jetzt nicht mehr gefragt; sie kollidierten in der Vergangenheit allzu oft mit der Realität. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Weltrettung 2.0, eine neue Form des Klimaschutzes, die auf Pragmatismus setzt statt auf Maximalforderungen. Mit ein paar Dogmen müssen wir aufräumen, dann kann das Projekt gelingen.
Europa ist nicht der Nabel der Welt
Im Vergleich der Pro-Kopf-Emissionen stehen die 27 EU-Staaten heute schon deutlich besser da als andere Industrienationen. Insgesamt liegt Europas Anteil an den globalen CO₂-Emissionen nur bei 6,44 Prozent, entsprechend gering ist der Hebel auf das Weltklima. Ökonom Johannes Holler vom österreichischen Fiskalrat:
«Der Europa-Zentrismus ist ein Phänomen, das nicht nur die Klimapolitik betrifft. Wir Europäer beschäftigen uns viel zu sehr mit uns selber und lassen dabei ausser Acht, wie der Rest der Welt auf ein Thema blickt. Zusätzlich hat man auf internationaler Ebene Zielen zugestimmt, ohne viel darüber nachzudenken, wie realistisch sie gesteckt waren und was deren Umsetzung wirtschaftlich auslöst. Und der bisherige europäische Ansatz 'Wir gehen mit gutem Beispiel voran‘ ist in Zeiten wie diesen nur schwer vermittelbar.»
Im Licht der wirtschaftlichen Machtverhältnisse ist es tatsächlich eine Farce, dass Länder wie China oder Saudi-Arabien bei den Klimakonferenzen hartnäckig ihren Status als Nehmer-Länder verteidigen. Klimaschutz ist in der internationalen Diplomatie längst zu einem politischen Spielball geworden, und die Europäer haben sich allzu leicht erpressbar gemacht. Der deutsche Top-Ökonom Joachim Weimann nennt es eine «Klimapolitik-Katastrophe»:
«Wenn sich ein Land einem Emissionshandelssystem angeschlossen hat, sind alle nationalen Klimamassnahmen wirkungslos. Der Bau von Windkraftanlagen ebenso wie regulatorische Massnahmen, die den Stromverbrauch senken. Deshalb muss Klimapolitik prinzipiell international – und das heisst für uns: europäisch – gedacht werden. Allerdings darf man auch davon zunächst nicht zu viel erwarten. Ein Blick auf die weltweite Rohölproduktion zeigt, dass diese genauso steigt wie die globalen Emissionen. Das Öl, das Europa nicht verbrennt, wird eben woanders verwendet.
Im Ergebnis zeigt sich ein ziemlich desaströses Bild: Nationale Klimapolitik bürdet den Menschen erhebliche Lasten auf, greift tief in ihre individuellen Freiheitsrechte ein und hat keinerlei Wirkung auf die globalen Emissionen. Dabei bestünde die politische Aufgabe eigentlich darin, Klimaschutz so zu organisieren, dass die dabei entstehenden Lasten möglichst gering ausfallen. Wenn man die Kosten ignoriert, ist das nicht möglich.
Europäische Klimapolitik ist besser, hat aber global ebenfalls kaum Wirkung, wenn es nicht gelingt, die grossen Länder ausserhalb Europas zum Mitmachen zu bewegen.»
(Joachim Weimanns gesamten Report finden Sie online auf derpragmaticus.com.)
Das Öl, das Europa nicht verbrennt, wird anderswo verwendet.
Doch wie sieht es auf nationaler Ebene aus? Gerade in Österreich hat sich in den letzten Jahren vieles zum Besseren gewendet, meint Helmut Berrer vom Wirtschaftsforschungsinstitut Economica:
«Insgesamt liegt Österreich bei den CO₂-Emissionsintensitäten (Emissionen pro Euro Bruttowertschöpfung) im Vergleich zu anderen EU-Staaten beachtlich gut. Besonders gilt das, wenn man sich vor Augen hält, dass wir noch immer einen relativ hohen Anteil industrieller Produktion haben, auf Kernkraft verzichten und viel Transitverkehr über die Strassen fährt. Viele Degrowth-Anhänger vergessen gern, dass die Produkte, die nicht bei uns hergestellt werden, dann zum Teil aus Ländern mit weitaus weniger strengen CO₂-Regelungen kommen würden.»
Mit anderen Worten: Eine europäische Deindustrialisierung würde dem Weltklima sogar schaden. Und natürlich liefert auch die aktuell eher triste Wirtschaftslage Argumente für ein Hinterfragen der bisherigen Koste-es-was-es-wolle-Klimapolitik. Helmut Berrer, der Mathematik studiert hat, hält zu diesem Themenkomplex fest:
«Österreich hat bekanntlich ein hohes Budgetdefizit, es herrscht extremer Sparbedarf. Dies erfordert nun kurz- bis mittelfristig budgetäre Kompromisse bzw. Einschnitte bei den Förderungen und Ausgaben des Staats, wobei der Klima- und Energiebereich dabei nicht prinzipiell ausgeklammert ist. Wenn wir den Wohlstand unserer Gesellschaft langfristig erhalten wollen, braucht es einen strategischen Plan, wie die teilweise gegensätzlichen Ziele von Ökologie und Ökonomie bestmöglich in Einklang gebracht werden können.
Dafür benötigt man aber eine fundierte, empirische Entscheidungsgrundlage, die jedoch (in der Vergangenheit) aufgrund der teilweise mangelhaften Datenverfügbarkeit in Österreich oft nicht gegeben ist. Das muss sich ändern, damit die Politik daten- und faktengestützte Entscheidungen treffen kann.»
Es ist also Zeit für einen neuen Klimarealismus – jenseits von missionarischem Eifer und politischem Moralismus. In der Kommunikation haben grüne Aktivisten ihr Blatt überreizt, das zumindest meint die Soziologin Gertraude Mikl-Horke:
«Es ist auf Dauer nicht hilfreich, eine Wir-retten-den-Planeten-Parole auszugeben, wenn die Welt ringsum sichtbar anders reagiert. Schafft es die Politik nicht, die Mehrheit der Menschen zu überzeugen, folgt die Stunde der Populisten.»
Und die hat bereits geschlagen, wie die jüngsten Wahlen in Österreich, den USA und in Deutschland zeigten. In den USA schwingt das politische Pendel mit voller Wucht zurück. US-Energieminister Chris Wright nennt den bisherigen Plan der Klimaneutralität bis 2050 «ein finsteres, furchtbares Ziel», Finanzwelt und Wirtschaft legen brav eine 180-Grad-Wende hin. Der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock rief «Energiepragmatismus» als neues Ziel aus und verliess die ursprünglich ambitioniert auf Nachhaltigkeit gepolte «Net Zero Asset Managers Initiative».
Degrowth-Vertreter vergessen gerne, dass die Produkte dann aus Ländern mit weniger strengen CO₂-Regelungen kommen würden.
Inzwischen haben auch die Finanzriesen JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley und die Bank of America den mächtigen, aus über 300 Großunternehmen bestehenden Öko-Wirtschaftsklub verlassen. BP, einst Vorreiter in der ökologischen Rolle unter den Energiekonzernen, will nach massiven Gewinneinbrüchen und einem darauf folgenden Führungswechsel die Investitionen in erneuerbare Energien kürzen und die Ölproduktion bis 2030 steigern.
Verlorene Öko-Unschuld
Und was passiert in Europa? Im Zuge des «Green Deal» hat die EU-Kommission seit 2019 über 70 weitreichende Umweltgesetze verabschiedet. Aber selbst in Brüssel wurde inzwischen verstanden, dass das Thema Klimaschutz seine Unschuld verloren hat. Helmut Berrer erklärt:
«Die Idee einer allumfassenden Vision, wie sie die EU mit dem Green Deal umzusetzen versuchte, ist zwar grundsätzlich charmant, hat aber auf operativer Ebene viel zu viele ökonomisch relevante Baustellen gleichzeitig aufgerissen. Effektiver wäre es wohl gewesen, klare und leichter erreichbare Teilziele zu definieren und dann dafür zu sorgen, dass diese auch optimal umgesetzt werden.»
Es ist auf Dauer nicht hilfreich, eine Wir-retten-den-Planeten-Parole auszugeben, wenn die Welt ringsum sichtbar anders reagiert. Schafft es die Politik nicht, die Mehrheit der Menschen zu überzeugen, folgt die Stunde der Populisten.
Heute ist der einst gefeierte Green Deal ein politischer Scherbenhaufen, praktisch auf allen Ebenen wird heftig zurückgerudert. Die neue Parole heisst «Clean Industrial Deal», bei dem wieder Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund stehen sollen.
Bürokratische Monster wie das Lieferkettengesetz werden entschärft, und die Autoindustrie darf auf eine Lockerung des Verbrennerverbots hoffen, weil inzwischen ein wirtschaftlicher Totalschaden droht. Es ist rückblickend völlig unverständlich, warum ein Wirtschaftsbereich wie die Autoerzeugung, in dem Europa eine klare Technologie-Führerschaft beanspruchte, für zweifelhafte, weil global kaum wirksame Klimaziele geopfert wurde. In der Produktion von Elektroautos dominieren die Chinesen, das ist lange bekannt.
Inzwischen stehen in der einst stolzen und renditestarken Kfz-Branche Hunderttausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. In Österreich wird die Liste der insolventen Zulieferbetriebe mit jedem Monat länger, so Helmut Berrer:
«Verbote sind als wirtschaftspolitische Lenkungsmassnahme prinzipiell zu hinterfragen. Der gesetzliche Rahmen sollte vielmehr sicherstellen, dass sich der Markt unter Berücksichtigung und Einhaltung der politischen Zielvorgaben bestmöglich entfalten kann. Dadurch bleiben die Produkte erschwinglich und die Herstellung wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll.»
Klares Learning aus den Erfahrungen mit dem Verbrennerverbot: Ausserhalb von autokratischen Systemen hat am Ende immer noch der Kunde respektive Wähler recht.
Es stellt sich auch die Frage, ob eine mit enormem Tempo betriebene Energiewende nicht bloss neue Abhängigkeiten hervorruft. Es scheint, als hätte Europa nichts aus der Geschichte gelernt: Die 1970er-Jahre bescherten uns gleich zwei Ölkrisen (1973 und 1979/80); und der Ukrainekrieg machte die Abhängigkeit von russischem Gas deutlich. Bei der Energiewende geht kaum etwas ohne Solarpaneele, Windräder, Batterien und vor allem seltene Erden aus China. Mehr Technologieoffenheit würde hier auch Risikostreuung bedeuten.
Viel Geld, wenig Wirkung
Forscher der Wirtschaftsuniversität Wien haben kürzlich eine verheerende Rechnung präsentiert: Alle politisch verordneten Klimamassnahmen brachten seit 2005 nur eine Reduktion um 2,5 Prozent. Und das, obwohl Österreich jedes Jahr beträchtliche Summen für den Klimaschutz ausgibt. Helmut Berrer von Economica meint:
«2023 wurden vom Bund und den Gebietskörperschaften 11,3 Milliarden Euro an Klimaschutzförderungen ausgezahlt. Das war in Relation zu anderen Aufgaben des Staats eine hohe Summe.»
Verkehrsmassnahmen haben sich im Vergleich zum Gebäudebereich als sehr kostenintensiv erwiesen.
Wegen der mangelhaften Transparenzdatenbank des Klimaschutzministeriums lassen sich die Auszahlungen keinen konkreten Empfängergruppen zuordnen. Mit anderen Worten: Die Regierung hatte offenbar nur wenig Ahnung, was die Klima-Milliarden überhaupt bewirken. Dazu Johannes Holler vom Fiskalrat:
«Die Frage der Kosteneffizienz von Klimaschutzmassnahmen wurde in Österreich bisher weitestgehend vernachlässigt. Es fällt auf, dass die Kostenseite des nationalen Energie und Klimaplans extrem schwer nachvollziehbar ist, während die Wirkungsseite sehr gut aufbereitet wurde. Beim Klimaschutz scheint Geld keine Rolle gespielt zu haben. Nach unserem Ansatz ist die Energiewende aber kein Free Lunch. Das dort verwendete Geld fehlt für andere Aufgaben.»
Tatsächlich dürfte es auch um Klientelpolitik gegangen sein. Am Beispiel Elektroauto: Der deutsche ADAC errechnete für die Lebensdauer (240'000 km) eines Kompaktklasse-Pkw mit E-Antrieb eine CO₂-Einsparung von 27,5 Tonnen gegenüber einem gleichwertigen Verbrenner. Bei der bisherigen E-Auto-Förderung von 5000 Euro (ca. 4673 Fr.) ergibt das einen Preis von 182 Euro (170 Fr.) pro Tonne eingespartes CO₂. Ein teurer Spass, zumal noch weitere Förderungen für Stromer existieren, aber ein Schnäppchen gegenüber dem Klimaticket. Dieses verursachte laut einer parlamentarischen Anfrage Kosten von 2462 Euro pro Tonne CO₂ – das ist mehr als das 30-Fache des Handelspreises für die Emissionsrechte, der bei 75 Euro pro Tonne CO₂ liegt.
Johannes Holler: «Internationale Handelszertifikate sind aus ökonomischer Sicht sehr nützlich. Mit den gleichen Investitionen könnte in anderen Ländern viel einfacher CO₂ eingespart werden, etwa durch erneuerbare Energiegewinnung und bessere Kraftwerkstandards in weniger industrialisierten Ländern.»
Was nützt? Was schadet?
Wie würde nun eine effiziente Klimapolitik aussehen? Die Ökonomin Susanne Maidorn vom Fiskalrat:
In der Vergangenheit waren Klimaschutzmassnahmen stark auf staatliche Förderungen fixiert, was sich der Bevölkerung gut vermitteln lässt. Die Auszahlungen für den Klimabonus lagen sogar um 300 Millionen Euro höher als die Einnahmen aus der CO₂-Steuer. Eigentlich müsste man die Wirkung der Fördermassnahmen sehr genau beobachten und in Relation zu den jeweiligen Kosten setzen. Das machte der Staat bisher nicht, deshalb ist der Mitteleinsatz auf diesem Gebiet nicht immer effizient. Der bessere Weg wäre, bisherige Massnahmen zu evaluieren und dann jene weiterzuführen, die in der Praxis den besten Effekt gezeigt haben. Das Klimaargument sollte nicht mehr für andere Zielsetzungen missbraucht werden, wie das in der Vergangenheit durchaus passiert ist.»
Als prototypisches Beispiel sieht die Ökonomin des Fiskalrats das «Zielnetz 2040» der ÖBB, das mit 26 Milliarden Euro budgetiert ist. Susanne Maidorn:
«Verkehrsmassnahmen haben sich als sehr kostenintensiv erwiesen, wobei Förderungen für E-Autos noch vergleichsweise günstig sind. Der Bahnausbau ist dagegen als Klimaschutzinstrument extrem teuer. Deshalb ist es falsch, ihn unter diesem Titel der Bevölkerung verkaufen zu wollen. Im Vergleich zu Verkehrsmassnahmen lassen sich im Gebäudebereich Emissionseinsparungen mit deutlich geringeren Kosten und damit höherer Effektivität erzielen. Dabei gilt: Je grösser die Gebäude, umso mehr Wirkung zeigt das eingesetzte Geld.
Also sollte der Fokus auf öffentliche und betriebliche Gebäude gelenkt werden. Um den CO₂-Ausstoss zu senken, wären grundsätzlich CO₂-Steuern und handelbare Emissionen geeigneter als Subventionen. Das Smarte an preisorientierten Mechanismen ist ja, dass jede Person individuell die beste Lösung zur CO₂-Vermeidung treffen kann. Eventuell bräuchte es hier Sonderlösungen für energieintensive Branchen oder einkommensschwache Haushalte. Aber Förderungen nach dem Prinzip Gießkanne werden nie eine hohe Kosteneffizienz erreichen.»
Im Fall der Sanierungsoffensive „Raus aus Öl und Gas“ stieg der Budgetbedarf von 500 Millionen Euro im Jahr 2023 auf fast eine Milliarde im Jahr 2024. Der Fiskalrat argumentiert hier wohl nicht ganz zu Unrecht, dass die Betriebskostenvorteile bei einem privaten Heizungswechsel so groß seien, dass die Dinge auch ohne massive Förderungen in Gang gekommen wären – allerdings langsamer.
An windstarken Sonnentagen wird grüner Strom zu Müll degradiert, weil der Anbieter für die abgenommene Ware bezahlen muss.
Nackte Zahlen
Im betrieblichen Bereich ermittelte das Wirtschaftsforschungsinstitut Econmica auf der Basis von EU-Daten – Österreich-Zahlen existieren bekanntlich nicht – CO₂-Einsparungsmöglichkeiten, die sogar deutlich unter dem Emissionshandelspreis von etwa 75 Euro pro Tonne CO₂ liegen: erneuerbare Energiequellen, Wärmeverteilung (11 Euro/t CO₂), Nutzung von Abwärme (20 Euro/t CO₂) und Klimatisierung (28 Euro/t CO₂). Der Kesseltausch in Betrieben (78 Euro/t CO₂) zeigt sich fast doppelt so effizient wie in privaten Haushalten (135 Euro/t CO₂). Die Moral aus der Geschichte: Klimaökonomie scheint im grossen Massstab weitaus besser zu funktionieren als individuelle Massnahmen, die zum Wählerfang missbraucht werden. Helmut Berrer:
«Allerdings braucht die Wirtschaft unbedingt langfristige Ziele, um ihre Produktionskapazitäten anpassen zu können. Kurzfristige Änderungen kosten in diesem Bereich enorm viel Geld. Die Ziele müssen aber realistisch und sinnvoll sein und dürfen nicht von irgendwelchen politischen Visionen definiert werden.»
Innovationsschub gefragt
Mehr Pragmatismus würde beim Energiethema nicht nur das Budget schonen, sondern könnte sogar für zusätzliche Arbeitsplätze und einen Innovationsschub sorgen. Es müsste allerdings ein völlig anderer Ansatz verfolgt werden, meint Georg Brasseur, emeritierter Professor für Elektrotechnik:
«In den vergangenen Jahren der Energiewende hat sich leider wenig zum Guten verändert, weil die Klimapolitik auf mehreren grundsätzlichen Fehlern beruht. Bereits heute kann zu viel Wind und/oder Sonne zu einem Überangebot an elektrischer Energie führen. Im Netz muss aber zu jeder Sekunde eine nahezu perfekte Übereinstimmung zwischen Erzeugern und Verbrauchern herrschen. Blackouts können durch zu wenig, aber auch durch zu viel erzeugten Strom entstehen.
Ein Überschuss kann sogar gefährlicher sein, weil der einmal produzierte Strom auf jeden Fall fliessen muss. Deshalb herrschen an windstarken Sonnentagen an den Strombörsen inzwischen Negativpreise. Eine wirtschaftlich absurde Situation, die grünen Strom sozusagen zu Müll degradiert, weil der Anbieter für die abgenommene Ware bezahlen muss. Andererseits wird für jede fehlende Kilowattstunde grüner Energie ein jederzeit abrufbares, zeitweise ungenütztes Netz aus Back-up-Kraftwerken und Speichern benötigt. Je mehr grüne Energie, umso mehr Back-up-Kraftwerke mit immer kürzerer Nutzungsdauer – ein enorm teurer Teufelskreis.»
All diese kostspieligen Faktoren werden von Energieversorgern selbstverständlich auf die Endkunden umgeschlagen. Das hat die Strompreise in den vergangenen Jahren drastisch erhöht, und es sieht nicht danach aus, als ob sich dieser Trend in absehbarer Zeit ändern würde – eine weitere enorme Belastung für die Volkswirtschaft, die noch zu den staatlichen Investitionen in die notwendige Infrastruktur hinzukommen. Brasseur dazu weiter:
«Gleichzeitig stösst der Ausbau des Hochspannungsnetzes an Grenzen, weil dieselben Akteure, die lautstark für die Energiewende eintreten, den Bau von Pumpspeicherkraftwerken und Infrastruktur seit Jahrzehnten erfolgreich blockieren. So hat der Bau der 174 Kilometer langen Salzburg-Hochspannungsleitung 16 Jahre in Anspruch genommen. Angesichts dessen wäre es ein Verbrechen am Vermögen unseres Landes, das kostbare und perfekt funktionierende Gasnetz zurückzubauen, wofür es in der Politik absurderweise ernsthafte Bestrebungen gibt.
Es wird offensichtlich physikalisch nicht verstanden, dass die Transportleistung einer Gaspipeline um weit mehr als eine Grössenordnung höher ist als von Strom. Oder anders formuliert: Jede stillgelegte Gaspipeline (Nord Stream 1 hatte ca. 63'000 MW Transportleistung) müsste durch 21 Salzburg-Hochspannungsleitungen (380 kV mit je 3000 Megawatt Transportleistung) ersetzt werden. Realistisch? Eher nicht.»
Wasserkraft, Wind und PV-Anlagen bestritten 2023 gerade einmal 15 Prozent vom heimischen Primär-Energiemix, daher meint Brasseur:
«Es erscheint also einigermassen utopisch, in den nächsten 15 Jahren einen 100-prozentigen Stromanteil anzustreben. Deshalb brauchen wir Innovationen, die mit fossiler Energie versorgte Prozesse signifikant optimieren und damit die Treibhausgase auch ohne Einsatz von grüner Energie senken. In den Städten könnte das mittels Ersatz von Gasthermen durch gasbetriebene Wärmepumpen und Blockheizkraftwerke in Hausanlagen geschehen. Die Halbierung der CO₂-Emissionen durch Effizienzsteigerung lässt sich schneller und mit weniger Aufwand realisieren und ist damit viel wirkmächtiger. Herrscht später ein Stromüberschuss, könnte das damit erzeugte grüne Gas je nach Verfügbarkeit beigemischt werden. Kleine, schnell umsetzbare Massnahmen würden also schneller und effektiver zum Ziel führen als die grosse Stromrevolution.»
Lokal statt global denken
Der Romancier und grüne Vordenker Jonathan Franzen schrieb bereits 2019 in einem viel beachteten Essay:
«Dem Klimawandel den totalen Krieg zu erklären, war nur sinnvoll, solange er sich noch gewinnen liess. Sobald wir akzeptieren, dass er bereits verloren ist, gewinnen anders geartete Massnahmen an Bedeutung.»
In der eigenen Öko-Gemeinde wurde er für diese Sichtweise scharf kritisiert. Sechs Jahre später können sich auch ökologisch denkende Wissenschaftler dieser Sichtweise anschliessen – wie der auf Wasserwirtschaft und Gletscherforschung spezialisierte Geograf Ulrich Strasser:
«Der Klimawandel wird kommen, keine Frage, die Auswirkungen sind längst spürbar. Aber das Weltklima ist ein enorm träge reagierendes System, das kommt in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu wenig zur Geltung. Stattdessen wird der Klimawandel in hohem Ausmass instrumentalisiert. Wenn heute irgendwo ein Hochwasser, eine Lawine oder ein Steinschlag passiert, dann ist in den Medien mit dem Klimawandel schnell ein Schuldiger gefunden. Das klingt, als hätte es früher keine Naturkatastrophen gegeben.
Nötig wäre eine viel ehrlichere Trennung zwischen tatsächlichen Klimafolgen und ideologisch motivierten Zuschreibungen. Denn die wahren Ursachen liegen oft bei Fehlern in der Flächenwidmung, bei Planungen und im Bau. Es braucht auf jeden Fall mehr Sensibilität im Umgang mit ungenützten Flächen, die in der Natur eine ungeheuer wichtige Funktion haben. Denn Wasser holt sich immer den Platz, den es braucht.»
Anpassung ans Unvermeidbare
Statt auf Emissionsvermeidung um jeden Preis sollte sich der Fokus auf bessere Anpassung richten, meinen Experten. Dabei wären die wichtigsten und effizientesten Massnahmen: mehr ausgewiesene Hochwasserzonen, lokale Wassergroßspeicher, Hitzevorsorge in den Städten, eine Umstellung der Land- und Forstwirtschaft auf die kommenden Klimabedingungen.
Ob sich der Klimapragmatismus durchsetzen kann, wird stark von der öffentlichen Wahrnehmung abhängen. Bisher waren Katastrophenmeldungen für Medien und Forschende eine Win-win-Situation: Je schlechter die Nachricht, umso höher die Aufmerksamkeit. Ulrich Strasser: «Leider ist das Thema auch zum Angstinstrument geworden, und mit Angst hat sich schon immer gut Geld verdienen lassen.»
Werbung